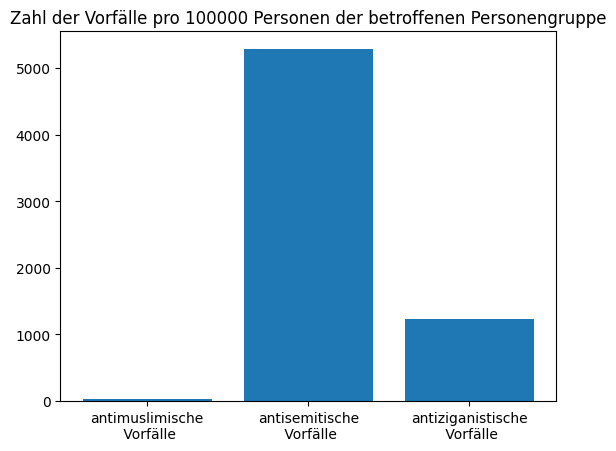Mit Beginn der aktuellen Wirtschaftskrise entstanden weltweit neue soziale Bewegungen. Zahlreiche anarchistische Prinzipien wurden spontan und oft auch ohne Wissen um die lange Tradition anarchistischer und syndikalistischer Bewegungen „neu erfunden“ und angewandt. Zwei dieser neuen Bewegungen sind die Marea Granate und die Grupo de Acción Sindical (G.A.S.). Interessanterweise halten sich diese nicht mehr an nationale oder geographische Grenzen. Stattdessen breiten sie sich weltweit aus. Dabei verstehen sie einerseits ihre Migration als erzwungen und andererseits wollen sie mit anderen gemeinsam gegen die Auswirkungen der Krise kämpfen, ohne Rücksicht auf die sogenannte „Herkunft“. Dies darf aber nicht so verstanden werden, dass es ihnen nur um kosmetische Veränderungen ginge. In ihrem Manifest schreiben sie unter anderem: „Wir rufen zur Analyse auf und verurteilen die zerstörerischen Folgen des aktuellen Wirtschaftssystems. Einerseits durch die Identifizierung der Ursachen, die uns dazu brachten unsere Heimatorte, unsere Familien und unsere Freunde zu verlassen. Andererseits durch das Hervorheben der schwierigen Lebensbedingungen der Migranten und Migrantinnen. Wir sind uns bewusst, dass wir keinen isolierten Kampf führen, und dass die Ursachen, die dazu geführt haben, Spanien zu verlassen anderen Ländern auch nicht fremd sind. Deswegen wollen wir Brücken zu lokalen Gruppen um uns herum bauen. Darüber hinaus gibt es andere Einwanderer- und Einwanderinnen-Gruppen in unseren Gastländern, mit denen wir zusammenarbeiten, um ein gegenseitiges Support-Netzwerk für Neuankömmlinge zu schaffen.“Für die Direkte Aktion sprachen Frank Tenkterer von der FAU Düsseldorf und Rita von der FAU Duisburg mit Nuria und Manel von den Gruppen Marea Granate NRW und G.A.S. NRW. (Redaktion Hintergrund)

Frank: Was ist Marea Granate? Wo kommt ihr her, und was ist die Basis eures Zusammenschlusses?
Nuria: Wir sind die Kinder der Krise. Ursprünglich haben wir in Spanien gegen die Krise gekämpft. Wir waren Teil der Bewegung 15M, die 2011 erstmals öffentlich aufgetreten ist. Damals haben wir gegen die Privatisierung des Gesundheitssystems, den Sozialabbau, die Wohnungsnot, die Ausweitung der prekären Arbeitsverhältnisse, die Arbeitslosigkeit und vieles mehr gekämpft. Allerdings zwang uns die Krise – und zwingt uns noch immer – ins Ausland zu gehen und dort nach Arbeit zu suchen. In diesem Sinne sind wir nicht gegangen, sondern rausgeworfen worden aus Spanien. Allerdings wollen wir den Widerstand gegen die Zerstörung des Sozialsystems und die permanenten Angriffe des Kapitals nicht aufgeben, nur weil wir dazu gezwungen wurden auszuwandern. Als Aktivist*innen tun wir uns auch weiterhin zusammen. Dabei bauen wir auf unseren Erfahrungen in Spanien auf. Die Basis unseres Zusammenschlusses ist die „Paella-Versammlung“. Marea Granate heißt übrigens „granatapfelrot“ und ist die Farbe unserer Reisepässe.
Frank: Gibt es Marea Granate nur in Deutschland?
Nuria: Als Marea Granate sind wir sozusagen der globale Arm der Bewegung 15M im Exil. Es existieren Gruppen auf fast allen Kontinenten, neben Europa vor allem in den Amerikas (Nord, Mittel und Süd) und in Australien. Einmal im Monat haben wir eine weltweite Vollversammlung im Internet, wo wir alles besprechen und uns über die aktuellen Entwicklungen in Spanien austauschen. Natürlich tauschen wir uns auch über die Situation in den jeweiligen Ländern aus, in denen wir im Exil leben müssen.
Frank: Wie organisiert ihr euch? Und wer kann bei euch mitmachen?
Neben der schon erwähnten „Paella-Versammlung“, zu der wir immer zum zweiten Sonntag im Monat in das FAUD-Lokal V6 in Düsseldorf einladen, organisieren wir uns vor allem über das Web und soziale Medien. Neben der Möglichkeit, unsere Homepage zu besuchen, kann man uns auf Twitter folgen oder via Facebook Kontakt mit uns aufnehmen. Untereinander nutzen wir Whatsapp und oft telefonieren wir auch ganz klassisch miteinander. Die Basis unserer Organisation ist aber die Versammlung. Dort besprechen wir alles, planen unsere Aktivitäten und integrieren neue Aktivist*innen.
Mitmachen darf bei uns eigentlich jede/r, der/die unsere Ziele teilt und unsere Art der Organisation akzeptiert. Du musst also keine Spanierin sein um bei uns mitmachen zu können. Allerdings ist unsere Verkehrssprache Spanisch.
Frank: Was sind eure Ziele? Und was sind eure konkreten Aktivitäten?
Nuria: Wir haben vier Ziele formuliert, die wir durchsetzen wollen:
Rückkehr zu einem Wahlrecht auf dem Stand von vor 2011. Das aktuelle Wahlrecht führt dazu, dass nur knapp 3 Prozent der im Exil lebenden Spanier*innen überhaupt an den Wahlen in Spanien teilnehmen. Seit der Krise sind viele Kritiker*innen der Regierung und speziell der konservativen ins Exil gegangen. Durch das neue Wahlrecht, das es schwieriger macht sich an den Wahlen zu beteiligen, werden zehntausende Stimmen erst gar nicht abgegeben und die Wahlen so ganz legal gefälscht.Gleicher und kostenloser Zugang zum Gesundheitssystem für alle. Nicht nur für Spanier*innen, sondern tatsächlich für alle. Nach einer sogenannten Gesundheitsreform ist es aktuell so, das Spanier*innen, die länger als drei Monate im Ausland sind, nicht mehr in Spanien versichert sind.Abschaffung der prekären Arbeitsverhältnisse. Es muss Schluss sein mit schlecht bezahlten und unsicheren Arbeitsverhältnissen. Arbeit auf ein paar Monate oder ein Jahr zu befristen oder nur noch über Sklavenhändler zu erhalten ist ein unannehmbarer Zustand, gegen den wir uns richten.Für die tatsächliche, bedingungslose innereuropäische Freizügigkeit. Bisher kann sich nur das Kapital in Europa wirklich frei bewegen. Uns, die wir nichts außer uns selbst haben, wird diese Freiheit faktisch verwehrt. Aber als Europäer*innen müssen wir das uneingeschränkte Recht haben, uns überall in Europa vollkommen frei bewegen zu können.
Diese vier Ziele wollen wir aber nicht nur in Bezug auf Spanien durchsetzen. Vielmehr wollen wir diese auch dort durchsetzen, wo wir gezwungenermaßen leben müssen. Und wir wollen das nicht nur für uns – sondern für alle! Für Marea Granate NRW macht es keinen Unterschied ob jemand aus Afrika, Asien oder Europa gekommen ist. Wir denken, dass es niemandem zuzumuten ist, unter prekären Bedingungen zu arbeiten, von politischer Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, keinen oder nur einen auf Basis des Einkommens beschränkten Zugang zum Gesundheitssystem zu haben oder sich in Europa nicht frei bewegen zu dürfen.
Neben einer Kundgebung im Mai vor dem Spanischen Konsulat, die leider wegen einer Unwetterwarnung kurzfristig ausfallen musste, entwickeln sich unsere Aktivitäten vor allem um das Online-Büro, das oficina precaria. Mit der Kundgebung wollten wir eigentlich gegen das neue „Sicherheitsgesetz“ demonstrieren. Mittlerweile ist es in Kraft und es gibt schon erste Opfer des Gesetzes. Uns erinnert diese Politik stark an das Frankistische Regime, das nach 40 Jahren wieder immer offener zu Tage tritt. Im Oktober werden wir anfangen, weitere Aktivitäten zu entwickeln. Unter anderem wollen wir eine Soli-Party organisieren. Wir brauchen natürlich Geld für Veranstaltungen und Publikationen. Mit der Party wollen wir aber auch auf uns aufmerksam machen und uns in Düsseldorf bekannt machen.
Frank: Du sprichst von Wahlrecht und politischer Mitwirkung. Ist Marea Granate so etwas wie eine neue Partei?
Nuria: Nein – Wie schon gesagt sind wir ein Teil der 15M Bewegung, der Indignados (der Empörten). Das bedeutet, dass wir wie Millionen andere Spanier*innen jedes Vertrauen in die Parteien und Politiker*innen verloren haben. Trotzdem haben wir aber eine politische Meinung. Diese drückt sich in unseren Zielen aus. Wir glauben aber nicht, dass wir diese als Partei durchsetzen könnten. Stattdessen müssen wir als reale soziale Bewegung, die sich selbst organisiert, die politische Kaste dazu zwingen, unsere Ziele umzusetzen.
Frank: Zurück zu euren Aktivitäten. Was ist das Online-Büro? Und welche Aktivitäten entwickeln sich daraus?
Nuria: Das oficina precaria ist unser Online-Büro, das heißt wir bieten den Menschen die Möglichkeit, sich mit all ihren Problemen und Fragen via E-Mail oder „privater Nachricht“ über Facebook bei uns zu melden. Bei vielen Problem können wir selbst helfen. Bei Problemen mit der Arbeit leiten wir die Leute an die FAU Düsseldorf weiter. Diese berät und unterstützt die Arbeiter*innen bei ihren Problemen. Ende Oktober laden wir ins FAUD-Lokal V6 zu einer Versammlung ein. Ziel ist es, eine Grupo de Acción Syndical zu gründen. Wir laden dazu extra Kolleg*innen der G.A.S. aus Berlin ein, die kurz vorher auf einem Treffen mit G.A.S. Paris gewesen sein werden. Die FAU Düsseldorf hat uns hier schon Unterstützung zugesagt. Wenn G.A.S. in Düsseldorf aktiv und handlungsfähig werden soll, dann werden wir nicht darum herumkommen, etwas über die Arbeitsgesetze in Deutschland zu lernen. Die FAU Düsseldorf wird im Winter also Seminare zum kollektiven und individuellen Arbeitsrecht organisieren und auch ein Organizing-Seminar. Die Seminare sind natürlich nicht nur für G.A.S., sondern für alle Interessierten offen. G.A.S.-Gruppen entstehen gerade weltweit. Dieser Prozess wird nötig, da wir den ständigen Angriffen von oben einen Klassenkampf von unten entgegenstellen müssen. Die Paella-Versammlungen und G.A.S. sind die zwei Seiten der Münze unseres Widerstandes.
Rita: Manel, du bist Aktivist bei G.A.S. Kannst du uns noch etwas genauer erklären was G.A.S. ist?
Manel: Die „Grupo de Acción Sindical“ (Gewerkschaftliche Aktionsgruppe) 15M-G.A.S. ist eine Arbeitsgruppe der spanischen 15M-Bewegung (die Empörten), deren Aufgabe darin besteht, Arbeiter*innen zu helfen, sich an ihrem Arbeitsplatz zu organisieren.

Rita: Was sind eure Ziele?
Manel: Eines unserer ersten Ziele ist es, die Einwander*innen zu unterstützen, um letztendlich ihre Integration in das deutschen Arbeitssystem und die Gesellschaft zu erreichen. Eigentlich spielen wir eine wichtige Bindungsrolle. Wir versuchen, nicht einfach als Service-Büro zu arbeiten. Wir wollen, dass die kämpfenden Beschäftigten die konkrete Form der angewandten Aktion für jede Auseinandersetzung selbst wählen und dass der Arbeitskampf mit unserer Hilfe selbstverwaltet stattfindet. Wir arbeiten grundsätzlich mit Arbeiter*innen-Gruppen. Individuelle Fälle leiten wir an eine andere Gruppe weiter, nämlich an das oficina precaria von Marea Granate. In der Praxis sieht es aber so aus, dass wir zur Zeit keinen kollektiven Fall haben (wir sind eine gerade neu entstandene Gruppe) und darum sind alle Mitglieder der G.A.S. momentan bei individuellen Fällen des oficina precaria voll involviert.
Rita: Wie organisiert ihr euch?
Manel: Alle wesentlichen Entscheidungen werden in Vollversammlungen getroffen. Funktionsträger*innen sind weisungsgebunden und können keine Beschlüsse fassen. Die Ämter sollen rotieren und sind natürlich unbezahlt. Wir haben keine Hierarchie und wir lehnen diese ab. Unsere Tätigkeiten basieren auf der Grundlage von Solidarität und gegenseitiger Unterstützung. Wir stehen keiner politischen Partei nahe. Wir sind unabhängig von anderen politischen und gewerkschaftlichen Organisationen. Das heißt nicht, dass unsere Leute nicht Mitglieder anderer Organisationen sein dürfen.
Rita: Wo kommt ihr her?
Manel: Die Gruppe gewerkschaftliche Aktion (G.A.S.) Nordrhein Westfalen kommt aus der Bewegung „15M Berlin“ und sie hat das Ziel, die ausgewanderten Arbeiter*innen zu unterstützen, um gemeinsam ihre Interessen an ihren Arbeitsplätzen zu vertreten und ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Dabei haben wir nicht nur die Unterstützung vieler deutschen Arbeiter*innen, sondern auch von deutschen Gewerkschaften. Wir kämpfen gegen Lohn-Dumping, Ausbeutung und Diskriminierung. In NRW bekommen wir gerade sehr viel Hilfe beim Aufbau durch die FAU.
Rita: Wer kann bei euch mitmachen?
Manel: Hauptsächlich arbeiten wir mit Migrant*innen, die Spanisch sprechen können, weil Spanisch unsere Verkehrssprache ist. Natürlich sind wir offen für alle Einwander*innen. Die meisten von uns können auch Englisch und wir werden uns sehr freuen, wenn Leute aus der ganzen Welt bei uns mitmachen wollen.
Rita: Wo gibt es G.A.S.?
Manel: In Moment nur in Deutschland. Es gibt aktuell drei aktive Gruppen: Berlin, Hamburg und NRW (Treffpunkt Düsseldorf). Außerdem gibt es Aktivist*innen in anderen Orten in Deutschland und Europa (z. B. Straßburg, Frankreich), die Interesse haben.
Rita: Was sind eure konkreten Aktivitäten in NRW?
Manel: Die neue Gruppe in NRW ist immer noch zu klein und wir haben uns bis jetzt nur mit individuellen Fällen beschäftigt. Darüber hinaus setzen wir unsere Kräfte in die Verbreitung der Gruppe, um uns sichtbarer zu machen und neue Mitstreiter*innen zu gewinnen.
Frank: Noch mal zurück zu Marea Granate. Nuria, du hast jetzt schon mehrfach die „Paella-Versammlung“ erwähnt. Was hat es damit auf sich?
Nuria: Unsere Treffen finden am Mittagstisch statt. Auf deutsch sagt man glaub ich „Ohne Mampf kein Kampf“. So ist es bei uns auch. Weil viele von uns Valencianos sind, also aus Valencia stammen, dem Ursprung der Paella, gibt es eben eine Paella. Wären wir aus Navarra, wäre es wohl eine Tortilla-Versammlung. Beim gemeinsamen Essen lernen wir uns gegenseitig kennen. Wir diskutieren nicht nur politisch, sondern tauschen uns über alle Aspekte unseres Lebens aus. Durch das Essen wird das Treffen auch weniger „formell“ und so nehmen auch ganze Familien an der Versammlung teil. Essen integriert. Vielleicht kann man es ein wenig mit dem sozialrevolutionären Abendbrot der FAU Düsseldorf vergleichen?
Frank: Ja, vielleicht kann man das. Gibt es noch etwas, was ihr unbedingt sagen wollt, was wir aber bisher noch nicht gefragt haben?
Nuria: Ja sicher (lacht). Wir wollen uns bei der FAU Düsseldorf und der FAU Duisburg für ihre selbstlose und herzliche Unterstützung bedanken. Und dann möchten wir natürlich alle Freund*innen des Widerstands, die ähnliche Ziele haben wie wir, einladen mit uns gemeinsam zu kämpfen. Uns geht es um gleiche Arbeit, gleiche Rechte und gleiche Möglichkeiten für alle Menschen. Egal aus welchem Land der Welt sie kommen. Wir sind überzeugt, dass wir das nur gemeinsam schaffen und dass wir dies nur auf den neuen Wegen schaffen können, die seit dem Ausbruch der Krise weltweit entstanden sind.Manel: Genau, wir möchten alle Interessierten herzlich einladen zu unseren Treffen zu kommen. Dabei spielt es keine Rolle ob ihr uns nur mal kennen lernen wollt, einen individuellen Fall habt, bei der G.A.S. mitmachen wollt oder Lust habt mit uns zusammen irgendeine Veranstaltung zu organisieren. Und vielleicht kommt ihr ja aus einer Stadt wo es bisher weder eine Gruppe der Marea Granate noch eine der G.A.S. gibt, dann helfen wir euch gerne beim Aufbau einer Gruppe und der Organisation von ersten Veranstaltungen.
Frank und Rita: Wir bedanken uns für das Interview.




 MARIA UND DAS HOTEL
MARIA UND DAS HOTEL