Vorgeschichte des Kampfes:
Nachdem seit Oktober 1931 der tariflose Zusatnd
für das Fliesengewerbe in Düsseldorf u. Umgebung
Wirklichkeit wurde und zwar deswegen weil es die
Unternehmer ablehnten, die von den Kollegen geforderte
Tarifsicherheiten und Granatien anzuerkennen,
machten sich innerhalb des Tarifgebietes
Düsseldorf Zustände breit und nahmen diese Zustände
Formen an, die man kurz betitelt mit –Unhaltbar-.
All die Errungenschaften seit Bestehen der
syndikalistischen Fliesenlegerorganisation 1901,
schienen beseitigt. Niemals und wenn die Arbeitslosigkeit
noch so scharfe Formen angenommen hätte,
wäre es den Unternehmern gelungen, die Kollegenschaft
solche Anerbieten zu machen, wenn nicht
hier wiederum die Bürokraten der reformistischen
und der christlichen Bauarbeiter-Organisation,
helfend im trauten Verein mit dem Syndikus der
Arbeitgeber-Verbände, die Düsseldorfer-PlattenFirmen
helfend beigesprungen wären. Was schert
diese Arbeiter-Vertreter, wenn dadurch auch ihre
eigne Mitgliedschaft, von deren Beitragsgroschen
sie ihr Drohnen-Dasein fristen, auf den Hund kommen.
Gerade diese Bürokraten waren es, welche den
tariflosen Zustand herbeiführten, indem sie die
Erklärung abgaben – einen solchen Tarif- wie ihn
die Düsseldorfer syndikalistischen Fliesenleger forderten
ablehnen zu müssen. Durch diese Erklärung
nahmen dann im Oktober 1931 die Arbeitgeber
ihre schon erfolgte Zusage zurück und da die Kollegen
erkannt hatten, das ohne diese geforderten
Sicherheiten, ein Tarifabschluß nur ein Mittel zur
Korruption sein kann, blieb man lieber tariflos. Die
Unternehmer ermutigt durch diesen erfolg, nutzten
nun die zum Dauerzustand gewordene Notlage
der Arbeiter aus und drückten durch systematische
Aussperrung aller unbequemen Geister, den Lohn
derart, das Löhne zur Auszahlung gelangten, welche
um das Jahr 1905 gezahlt wurden. Die Spaltung
der Kollegen in drei Organisationen Syndikalisten,
Reformisten und Christen, trug viel zur Schaffung
dieses Zustandes bei. Nur so ist es zu verstehen,
das die Düsseldorfer Fliesenleger, welche bis dahin
unter Führung der syndikalistischen Organisation
eine Spitzen-Position eingenommen hatten, auf
solchen Tiefstand gelangen konnten. Unsere Ka-meraden setzten sofort als die Lage immer unhaltbarer
wurde ihre besten Kräfte zur Schaffung einer
gemeinsamen Abwehrfront ein. Vorerst mit wenig
Erfolg, bis es endlich gelang im September des Jahres
1932 alle in Düsseldorf befindlichen Fliesenleger
ganz gleich welcher Organisationszugehörigkeit
zusammen zu bringen. In dieser Versammlung
wurde nach einem Referat unseres Kollegen C.
Windhoff die alte Forderung, Schaffung der tariflichen
Sicherheiten, Verteilung der vorhandenen
Arbeiten für alle in Düsseldorf sesshaften Kollegen
einstimmig gutgeheißen und neu aufgestellt. Die
Unternehmer wurden danach aufgefordert Stellung
zu diesen Forderungen zu nehmen u.s.w.
Um diese Forderungen der Düsseldorfer Kameraden
mehr Kraft zu versetzen, wurde die Verbindung
mit den umliegenden Städten, wie Cöln und
andere mehr aufgenommen, da dort dieselben
wenn nicht noch weit schlimmere Verhältnisse
eingerissen waren. Doch wieder waren es die Angestellten
des Deutschen Baugewerksbundes und
die Vertreter des Christentums aus den christlichen
Gewerkschaften, die ihren Kollegen die Erklärung
abgaben, für die syndikalistischen-Windhoff-Forderungen
setzen sie sich nicht ein und erzielten dadurch
tatsächlich in Cöln/Rhein, das Unterbleiben
einer Kampfstellung.
Ungeachtet dessen, benutzten die Düsseldorfer
Kameraden, die in ihrem Bereich hergestellte
Einheit der Arbeiterschaft und traten, da die Unternehmer
gestützt auf die Haltung der genannten
Arbeitervertreter es ablehnten die Forderungen
der Kollegen anzuerkennen mit dem 1.10. in den
Streik.
Die Streiklage:
Einmütig traten am 3.10.32 die Kollegen soweit sie
in Arbeit standen in den Kampf. Durch zwei größere
Bauplätze-Krankenhausum- und –anbau, sowie
bei den Persil-Werken, konnte die Forderung der
Fliesenleger größerer Nachdruck verliehen werden.
Denn von den insgesamt 36 streikenden waren
auf diesen genannten Baustellen allein 26 Mann in
Arbeit. Der Schlag war gelungen, die Arbeitslosen,
die zum Teil schon mehr wie ein Jahr aus dem Produktionsprozeß
ausgeschaltet waren, unterstützten
einmütig die Forderungen der streikenden Kollegen.
Die Hoffnung der Unternehmer und der Verbandsangestellten,
das diese arbeitslosen Kollegen
ihre streikenden Brüder in den Rücken fallen werden,
ist fehlgeschlagen. In dieser Einmütigkeit lag
ein beachtenswerter Erfolg, der um so höher eingeschätzt
werden muß, wenn man die ungeheuere
Notlage der deutschen Arbeiterschaft durch die
Wirtschaftskrise bedingt kennt. Der Kampfgeist ist
gut und schon vielen die Herzen der Unternehmer
in die Hosen, doch der Syndikus, diese besondere
Menschenart von Juristen springt ein, nachdem bereits
nach anderthalb Wochen die erste Plattenfirma,
die größte in Düsseldorf, durch die kurze Dauer
des Kampfes in Konkurs ging. Die Unternehmer
wandten sich nun jammernd an die Architekten
und Bauherren von Düsseldorf und Umgebung
und verlangten deren Hilfe bei dem Kampf gegen
die dreimal verfluchten Fliesenleger. Doch unsere
Kameraden nahmen geschickt diesen Schlag auf
und wandten sich nun ihrerseits an die Architekten
und Bauherren mit einer Flugschrift folgenden Inhaltes:
An die Herren Architekten.
Bauunternehmer und Bauherren!
Nach uns zugegangenen Informationen sind die Plattengeschäfte in Düsseldorf und Neuß an die Bauherren und Architekten mit der Bitte herangetreten, keinerlei Plattenarbeiten durch erwerbslose oder streikende Fliesenleger ausführen zu lassen. Hierzu gestatten wir uns folgendes zu sagen:
1) Wir lehnen jede Schwarzarbeit grundsätzlich ab.
2) Solange die hiesigen Plattengeschäfte unsere grundsätzlichen Forderungen – Tarifsicherung und Arbeitsteilung – respektiv abwechselnde Beschäftigung unserer erwerbslosen Kollegen – ablehnen, solange lehnen wir jede Arbeitsleistung für solche Plattengeschäfte strikt ab.
3) Wir sind bereit, von Fall zu Fall nach erfolgter
Prüfung jeden uns von Bauherren, Architekten,
Privaten und Behöreden erteilten Arbeitsauftrag
auszuführen, wenn man unsere grundsätzlichen
Forderungen anerkennt.
4) Bei allen von uns übernommenen Arbeiten werden
die dabei tätigen Fliesenleger ordnungsgemäß zur Kranken-Invaliden- und Unfall-Versicherungangemeldet, um jede Schwarzarbeit zu bekämpfen.
5) Als Facharbeiter sind wir weit besser in der Lage, für korrekte Ausführung und Haltbarkeit zu garantieren,
als wie die Inhaber der Plattengeschäfte. Die doch zu 9 Zehntel gelernte Kaufleute sind. Zudem ist ja jede zugesagte Garantie hinfällig, sobald das Plattengeschäft Pleite macht.Düsseldorf, den 12. Oktober 32.
Die gemeinsame Lohnkommission der Fliesenleger
Die damit bedingte Festlegung der Streikführung
und die damit geschaffene Gewähr einer weiteren
Einheitsfront, ließ nun die Bürokraten der Reformisten
und des Christentums nicht mehr ruhig
schlafen und ihrer Anschauung getreu schritten sie
zum Verrat.
Die Arbeit der Verräter:
Um die Einheit des Kampfes zu beseitigen schufen
die Angestellten des sogenannten freien Baugewerks-Bundes
und der Christen einen Pakt mit
dem Syndikus der Arbeitgeber und dem Arbeitgeber-Bund,
um mit allen Mitteln den Streik abzuwürgen.
Hinter dem Rücken der Streikenden, ohne
jede Fühlungnahme mit ihren Mitgliedern – welche
gemeinsam die Streikleitung stellten, schlossen sie
mit dem Arbeitgeberbund und Anrufung des amtlichen
Schlichters einen Tarif ab, welcher nicht im
mindesten die Forderungen der Belegschaften und
Kollegen Rechnung trägt.
Danach forderten sie ihre Mitglieder auf, den
Kampf einzustellen, da sie sonst nicht mehr den
Streik durch die Gewerkschaften finanzieren, auch
würden sie Mithilfe des Arbeitsamtes die Sperre
über die nicht gehorchenden Kollegen verhängen.
Was gleichbedeutend ist, das diejenigen Fliesenleger,
welche arbeitslos sind, während der Dauer des
Streiks keine Arbeitslosenunterstützung erhalten.
Durch diesen Verrat glaubten sie den Willen der
Streikenden gebrochen zu haben. Doch die Fliesenleger
ließen sich durch die Erfahrungen des nun
schon 4 Wochen andauernden Kampfes nicht einschüchtern.
In einer gemeinsamen Versammlung forderten sie von den Angestellten ihrer Organisationen
Rechenschaft über ihren Verrat. Tatsächlich
besaß der Angestellte des deutschen Baugewerksbundes
Schorgel-Düsseldorf die Unverfrorenheit,
in die Versammlung zu kommen und verlangte
dort, von den Kollegen die dem D.B.B. als Mitglieder
angehören, das sie den Streik abbrechen
und sich im Verlauf einer sich dadurch notwendig
machenden Abstimmung über die Weiterführung
des Streikes nicht mitzustimmen.
Es erübrigt sich darauf hinzuweisen, dass sich dieser
Mann eine eklatante Abfuhr holte. Das solche
jämmerlichen Figuren überhaupt den Mut besitzen,
ihren Verrat offen vor einem Forum Streikender zu
verteidigen, dürfte am besten beleuchten, wie wenig
eigne Courage sie ihrer Mitgliedschaft zutrauen.
Doch hier hatte sich der Mann verrechnet. Die
Mehrheit der Streikenden stimmte für Weiterführung
des Kampfes. Lediglich 5 Mann enthielten
sich der Stimme. Unsere Kameraden erkannten
sofort die Gefahr die kommen musste, wenn jetzt
nicht mit allen Mitteln vorgegangen wird. Denn es
ist schon immer ein Teil Wahrheit an alten Sprichwörtern,
die da besagen, „Wie der Herr, so das Gescherr“.
So zeigte sich auch hier, das Menschen mit
wenig Ehrgefühl und Rückgrat genug auf der Welt
herum laufen, noch dazu wo von Seiten einer korrumpierten
Sorte, die sich Arbeiter-Vertreter nennen,
diese jämmerliche Haltung Streikbrecher zu
werden, belohnt wird mit der Anerkennung brave
Genossen zu sein. Genug davon, die Kameraden in
Düsseldorf, die nun in der 4. Woche streiken, bleiben
zusammen. In einem Flugblatt an „Alle Bauarbeiter“
schilderten sie den Verrat, der Bezirksleiter
Chr. Ahrens-Cöln und des Angestellten, Vorsitzenden
des D.B.B. Düsseldorf K. Schorgel, sowie
des christlichen Angestellten C. Sauer. Sie sagten
in diesem Flugblatt der Öffentlichkeit, das diese
„Herren“ durch die Drohung der finanziellen Sperre
in der Unterstützung wie beim Arbeitsamt sich
9 Fliesenleger des D.B.B. und zwei der Christen
als Streikbrecher in den Dienst der Unternehmer
gestellt haben. Durch besonderen Hinweis, das in
diesem und jenem Hause Streikbrecher mit Namen
genannt arbeiten, erhoffen sie durch die Solidarität
der übrigen Bauarbeiterschaft diese feigen Gesinnungslumpen
zu beseitigen. Der Kampf wurde
trotz dieser Infamie weiter geführt. Dadurch
gedemütigt und sich um ihren Erfolg betrogen
sehend, wandten sich die „Vereinigten“ Bundesgenossen
an das „Landesarbeitsamt“, um ja nichts
unversucht zu lassen, den Kampf der nach wie vor
unter Führung der Syndikalisten liegt, das Genick
zu brechen. In der 6. Streikwoche erhielten dann
auch einige Kollegen unserer Organisation eine
Drohung durch das Landesarbeitsamt zugesandt,
mit dem Vermerk, einer größeren Geldstrafe oder
6 Wochen Gefängnis bestraft zu werden, wenn die
Freie Vereinigung der Fliesenleger auch fernerhin
Arbeitskräfte vermittelt, ohne dazu das Landesarbeitsamt
zu benutzen. Nun unsere Kollegen ließen
sich nicht einschüchtern und hatten sehr schnell
herausgefunden, wer diese Kampfesart zur Erledigung
des Streiks ausgetipt hat. In einer Beschwerde
über die Strafandrohung wird um Klarstellung
dieser Angelegenheit ersucht. Eine Antwort darauf
ist noch nicht eingetroffen. Der Kampf geht ungebrochen
weiter.
Streik in Essen:
Durch den Streik der Düsseldorfer ermutigt, haben auch die Kameraden in Essen, sich zum Streik ermutigen lassen. Da hier unsere Kollegen als Syndikalisten in der Minderheit sind, schufen sie eine „Treugemeinschaft“ mit den Kollegen des D.B.B. und der Christen. Wie die Nachricht verlautet, stehen hier die Angestellten zur Zeit noch auf der Seite der Streikenden.
Der Kampf in Düsseldorf, der nun bereits 8 Wochen andauert, hat die vollste Unterstützung aller syndikalistischen Genossen und hoffen wir mit den Streikenden, das der Kampf mit Erfolg gekrönt
werde. Über den weiteren Verlauf wird das Sekretariat die Länder auf dem laufenden halten.
– W.M. –
Nachtrag zum Düsseldorfer FliesenlegerStreik:
Bereits bei Fertigstellen des Pressedienstes erhalten wir die Nachricht, das der Streik trotz seiner hoffnungsvollen Ansätze nach fast 8 wöchiger Dauer, durch der Verrat der vereinigten Reformisten, Christen und Unternehmer, sowie mit Hilfe des Staatsapparates aufgehoben werden musste. Damit ist aber, wie die Meldung besagt, der Kampf nicht beendet, sondern wird mit anderen Mitteln weiter geführt. Der Pressedienst wird in der nächsten Nummer näher darauf eingehen. –K–
• Presse-Dienst des ISBF, Jahrgang II, November 1932,
Nummer 7 [6 hektografierte A 4 Seiten]
In der Kampflinie – Warum haben die Fliesenleger in Düsseldorf die Arbeit eingestellt?
Die Lage bei den Fliesenlegern
Seit rund 30 Jahren sind die Fliesenleger eine der
bestorganisierten Gruppen im Baugewerbe und haben
es verstanden, sich im Laufe der langen Jahre,
besonders im Tarifbezirk Düsseldorf-Neuß, einigermaßen
annehmbare Lohn- und Arbeits-bedingungen
zu erkämpfen.
Abgesehen von einzelnen Ausnahmen waren
die Unternehmer immer bestrebt, die Tarifsätze zu
drücken.
So lange eine halbwegs gute Baukonjunktur bestand,
haben die Fliesenleger sich immer energisch
und mit Erfolg gegen die geplanten Lohnherabsetzungen
gewehrt.
Als aber dann die Baukonjunktur in den Jahren
1929 bis 1931 immer schlechter wurde, als es zur
Massenerwerbslosigkeit kam, da nutzten die Unternehmer
ihre wirtschaftliche Macht gegenüber
den Arbeitern rücksichtslos aus.
Entgegen den klaren Bestimmungen des gültigen
Arbeitsvertrages vom 5. September 1928 ließen die
Unternehmer dann zunächst diejenigen Leger, die
immer für die Durchführung des Tarifs eingetreten
waren, wochenlang feiern, mit der Begründung, es
sei keine Arbeit da.
Darin tat sich besondere die Firma OsterratherPlattenlager,
Inhaber Gustav Compes und Josef
Peck (damals Harkortstraße, jetzt Höherweg) hervor.
Im Jahre 1931 gingen die Unternehmer mehr und
mehr dazu über, die ihnen verhaßten, tariftreuen
Leger hinauszudrücken zum Stempelamt.
Rücksichtsloser Lohnabbau
Die bei den einzelnen Firmen verbliebenen Leger
wurden dann von den Unternehmern dahin
beeinflußt, doch billiger zu arbeiten, da man sonst
keine Aufträge hereinholen könne. Bald hier, bald
dort gaben charakterschwache Leger den zwar moralisch
verwerflichen, aber vielfach diktatorischen
Einflüsterungen der Unternehmer nach, trotzdem
der Tarif noch bis zum 1. September 1932 zu Recht
bestand.
Ein zügelloser, wilder Konkurrenzkampf wurde
von den Unternehmern inszeniert, mit dem Erfolg,
daß die Preise für fertige Arbeiten per Quadratmeter
zunnächst um 20 bis 30 Prozent, und dann, als
der Tarif nicht mehr bestand, um 50 bis 60 Prozent
herabgedrückt wurden.
In diesem Jahre ging dieser, jeder Vernunft hohnsprechende
idiotische Konkurrenzkampf lustig
weiter.
Dieselben Unternehmer, die noch vor zwei und
drei Jahren den Quadratmeter fertige weiße Wandplatten
für 18 bis 21 RM offerierten, bieten heute
dieselben Arbeiten für 7 bis 8 RM an.
Bei Majolikaplatten, früher 30 bis 40 RM per Quadratmeter,
heute 8 bis 15 RM.
Alles dies geschieht zunächst auf Kosten der Fliesenleger,
dann aber auch auf Kosten der Unternehmergewinne
und nicht zuletzt auch auf Kosten der
Lieferanten, der Plattenfabrikanten.
Die einzelnen Fabriken klagen in ihren Berichten immer wieder über die Schleuderpreise und über
die großen Ausfälle, die alle durch die Zahlungsunfähigkeit
der Abnehmer erleiden. Nicht nur daß
die Fabriken hunderttausende Reichsmark Einbuße
erleiden, sondern auch die Tatsache, daß alte, seit
Jahrzehnten bestehende Plattenfabriken in Konkurs
geraten sind, sollte zu denken geben.
Alles dies sind die Folgen der wahnsinnigen
Lohnabbaupolitik, die seit Jahren von den Unternehmern
verlangt und durchgeführt wurde.
Damit wurde die Kaufkraft der Masse den Volkes
und die Volkswirtschaft zerschlagen.
Die Löhne der Fliesenleger wurden durch Diktat
der Unternehmer willkürlich um 60 bis 75 Prozent
herabgesetzt. Bei einzelnen Firmen (B. Sch. und O.
Pl.) wurde die mit den Fliesenlegern vereinbarten
Akkordlöhne durch einseitiges Diktat nicht gezahlt.
Vielfach haben unsere Kollegen bei intensiver
Arbeit nur noch das Stempelgeld verdient.
Schon monatelang wußten die Unternehmer, daß
die Fliesenleger-Organisation eingreifen wollte
oder würde. Trotzdem ließen sich Unternehmer
sich auf Verhandlungen nicht ein und kehrten den
„Herrn-im-Hausstandpunkt“ hervor.
Eingreifen der Organisationen
Anfang September traten die Organisationen der
Fliesenleger wie folgt an den Arbeitgeber-Verein
heran:
An die Vereinigung der Arbeitgeber im Plattengewerbe,
z. Hdn. des Vorsitzenden Herrn Paul Dietz jr.
Düsseldorf, Düsselthaler Straße.
Höflichst bezugnehmend auf die Besprechung die unsere
Kollegen Wagner und Windhoff am 12. August mit Ihnen,
Herr Dietz, hatten fragen wir hiermit an, wann die angeregte
unverbindliche Besprechung zwischen den Arbeitgebern und
ans stattfinden kann. Angesichts der immer tiefer sinkenden
Preise für den Quadratmeter fertige Arbeit und des damit Hand
in Hand gehenden Drucks auf die Löhne liegt es doch wohl im
beiderseitigen Interesse, die diesbezüglichen Besprechungen
baldigst aufzunehmen.
gez.: C. Windhoff, P. Schneck für die
Vereinigung der Fliesenleger.
gez.: Andreas Cohnen, Albert Terhorst
für den Baugewerksbund.
gez.: Johann May für die Christl. Baugewerkschaft
Ihre gefl. Antwort bis Dienstag, den 13. d. M. an die Adresse
C. Windhoff erbeten.
Dazu lief folgende Antwort ein:
„Herrn C. Windhoff. Düsseldorf,
Grafenberger Allee 257.
Ihr Schreiben vom 6. September kam in den Besitz des Unterzeichneten
und haben wir dasselbe unserem vorgelagerten
rheinischen Verband zur Stellungnahme übergeben.
Arbeitgeberseits werden dieser Tage Besprechungen stattfinden
und kommen wir alsdann auf Ihr Schreiben, zurück.“
Aus diesem Schreiben ersehen wir, daß die
Herren gewillt waren, die Sache hinauszuschieben.
Um nun Dampf dahinter zu setzen, beschlossen
die im DBB, sowie die christlich und syndikalistisch
organisierten Fliesenleger am 13. September, daß
ab 1. Oktober 1932 zu den bisherigen Schundlöhnen
nicht mehr gearbeitet werden solle. Die in Ar-beit stehenden Leger teilten dann den einzelnen
Firmen schriftlich diesen Beschluß mit.
Alle Unternehmer verhielten sich ablehnend.
Dann endlich am 90. September, als am Ablauf des
gestellten Termins, schrieb der Arbeitgeberverband
uns, daß er eventuell bereit sei, mit uns zu verhandeln,
aber nur dann, wenn
1. die für den 1. Oktober, vormittags angesetzte
Versammlung der Fliesenleger ausfalle und
2. wenn wir als Organisation schriftlich erklären
würden, zu den bisherigen Löhnen weiter zu arbeiten.
Die Versammlung der Fliesenleger am 1. Oktober
lehnte diese Zumutungen einstimmig ab
und beauftragte die Lohnkommission, den Unternehmern
nachstehende Antwort zuzustellen:
„Die am Samstag, dem 1. Oktober 1932 stattgefundene
Fliesenleger-Versammlung der drei beteiligten Organisationen
hat zu den aufgestellten Schriften der Arbeitgeber-Vereinigung
vom 30. September und 1. Oktober Stellung genommen. Wir,
die Unterzeichnenden, wurden beauftragt, der Arbeitgeber-Vereinigung
über die Stellungnahme Fliesenleger-Organisationen
folgenden Bericht zu übersenden:
l. Der Versammlung ist nicht bekannt, wo und wann zwischen
einreißen Firmen und Legern rechtsverbindliche Arbeitsabmachungen
(Wochenarbeitszeit) abgeschlossen sind und damit
nicht in der Lage, eine diesbezügliche schriftliche Erklärung
abzugeben.
Soweit gilt 53 Abmachungen Kollegen, wird eine Verständigung
leicht zu erreichen
2. Falls in Verhandlungen über Abschlag eines Arbeits-,
Lohn- und Akkordtarifvertrages eingetreten wird, muß zunächst
die gegenseitige Tarifsicherung einwandfrei festgelegt
werden.
3. Soll die Arbeitsverteilung auf paritätischer Grundlage und
Arbeitsvertrag eingefügt und anerkannt, — und in der Praxis
streng durchgeführt werden.
4. Die Vorsammlung der drei Fliesenleger-Organisationen
hält die Durchführung dieser grundsätzlichen Forderungen (2
u. 3) für wichtiger, als die Festlegung hoher Tarifabschlüsse.
5. Die in Arbeit stehenden Fliesenleger erklären, daß sie nicht
mehr gewillt sind, zu den bisherigen von den Arbeitgebern einseitig
diktierten Schund- und Schandlöhnen die Arbeiten auszuführen.
6. Auf Antrag Windhoff beschließt die Versammlung:
Die in Arbeit stehenden Kollegen sollen allein durch Abstimmung
kundtun, ob sie Arbeit Montag, den 3. Oktober,
aufgenehmen oder so lange ruhen soll, bis die grundsätzlichen
Forderungen anerkannt sind.
Resultat ist:
„Die in Arbeit stehenden Kollegen beschließen einstimmig,
die Arbeit vorläufig ruhen zu lassen. Dann beschließen die Erwerbslosen
ebenfalls einstimmig allseitig weitgehende Solidarität
auszurufen.“
Soweit zur Information. — Von Herrn Diebs erbitten wir
nun Bescheid, ob die Herren bereit sind, sich auf Grundlage der
Punkte 2 und 3 mit uns zu verständigen.
Antwort erbitten wir nur an unsere gemeinsame Lohnkommission
z. Hd. C. Windhoff, täglich von 9 Uhr vormittags ab in
Haus Kroll, Am Wehrhahn Nr. 70, Fernruf 26966.
Für die Vereinigung der Fliesenleger gez.: Windhoff,
Schnock, G. Wagner.
Für den Baugewerksbund gez.: Terhorst, Albert, Andr. Kohnen
Für die christl. Baugewerkschaft gez.: Johann May.
Am 5. Oktober teilte der Arbeitgeberbund uns
dann schriftlich mit, daß er die von uns verlangte
Position 3 einstimmig abgelehnt habe.
Daraus ist ersichtlich, daß die Herren die
ihnen unbequemen tariftreuen Fliesenleger
auch in Zukunft von jeder Mitarbeit ausschalten
und dem Hunger ausliefern wollen.
Hinter dieser sozial rückständigen Einstellungder
Herren Unternehmer steckt als Treiber der Syndikus der Unternehmer, Dr. Frohn-Köln.
Wir kommen zum Schluß und stellen fest:
Während Regierung, Behörden und alle Gewerkschaften
kategorisch die Einstellung von Erwerbslosen
fordern, lehnen die Unternehmer im Fliesengewerbe
jede Mitbeschäftigung von Erwerbslosen
mittelst des Krümpersystems (x) radikal ab.
Die Unterzeichneten waren gewillt, sich auf gütlichem
Wege zu verständigen, die Unternehmer
aber wollten den Kampf.
Düsseldorf, den 10. Oktober 1932.
Für die gemeinsame Lohnkommission:
Vereinigung der Fliesenleger: C. Windhoff,
G. Wagner.
Deutscher Baugewerksbund: A, Terhorst,
A. Kohnen.
Christl. Baugewerkschaft: Johann May.
Streik!
Das bis hier Gesagte wurde als Flugblatt in einigen
Tausend Exemplaren im Streikgebiet verbreitet
und von den Bauarbeitern sympathisch begrüßt.
Die Unternehmen waren sich klar darüber und
haben eingestanden, daß es ihnen ohne Hilfe der
Gewerkschafts-Bürokratie unmöglich wäre, den
Streik siegreich zu bestehen.
Genau so wie bei dem Streik der Köl –
n e r F l i e s e n l e g e r i m J a h r e 1 9 2 5 wandten
sich die Herren in ihrer Not um Hilfe bittend an
die angestellten Kommandeure des Baugewerksbundes
und der christlichen Baugewerkschaft in
Köln und Düsseldorf und fanden dort bereitwilligst
Gehör und Verständnis.
Hinter dem Rücken und gegen den Willen
ihrer Mitglieder kamen diese Bonzen
und Schmarotzer mit den Unternehmern
und deren Syndikus Dr. Frohn dreimal im
Bahnhofs-Hotel und im feudalen Café Bittner
in Düsseldorf zusammen und beschlossen:
1. Die wichtigsten Forderungen der Fliesenleger
betr. Tarifsicherung und Arbeitsverteilung nach
dem Krümpersystem werden abgelohnt.
2. Der Streik wird abgewürgt.
3. Der staatliche Schlichter wird angerufen und mit
dessen Hilfe ein neuer Tarif – aber nur mit dem Baugewerksbund
und den Christen – abgeschlossen.
4. Die Syndikalisten, die den Streik inszeniert haben
und insbesondere deren Wortführer C. Windhoff,
werden von allen Verhandlungen ausgeschlossen.
5. Der Baugewerksbund und die Christen liefern
den Unternehmern die erfoderliche Anzahl Arbeitswillige.
6. Falls die Fliesenleger sich weigern sollten, die Arbeit
aufzunehmen, wird ihnen seitens der beiden
Verbände die Streikunterstützung entzogen.
7. Dem Arbeistamt wird mitgeteilt, der Streik sei
beigelegt und nunmehr sollen die nicht am Streik
beteiligten erwerbslosen Fliesenleger den bestreikten
Unternehmern vermittelt werden.
An diesem hinterlistigen verrackten Plan,
an diesem schmutzigen Arbeiterverrat
haben folgende Gewerkschaftsbürokraten mitgewirkt:
a) vom Baugewerksbund: Bezirksleiter Christian
Ahrens-Köln, Angestellter H. Jäger-Köln, Angestellter
und Vorsitzender Konrad Schergel, Düsseldorf,
Fliesenleger Albert Terhorst-Düssel-dorf;
b) von der christl. Baugewerkschaft; Bezirksleiter
Hausgen-Köln, Angestellter C. Sauer-Düsseldorf.
In treuer Waffenbrüderschaft mit dem Arbeitgeberbund
und Hand in Hand mit dessen Syndikus Dr.
Frohn haben dann die oben genannten Herren ihre
Beschlüsse durchgeführt, wohl haben sich zwölf
Arbeitswillige dank der Treiberei der beiden Verbände
gefunden, aber die Abwürgung des Streiks
ist nicht gelungen.
Am 31. Oktober und am 3. November nahmen
zwei stark besuchte Versammlungen der Fliesenleger
zu dem schmutzigen Sklavenhandel der Bü-
rokraten Stellung und beschlossen einmütig und
ohne Widerspruch:
Der Streik wird in verschärfter Form weiter
geführt gegen die Unternehmer und gegen
die als Knochen- und Sklavenhändler auftretenden
sozialdemokratischen und christlichen
Gewerkschaftshäuptlinge.
Arbeiter! Klassengenossen!
In der Presse und in ihren Verhandlungen, wo es
keine freie Diskussion gibt, da predigen die christlichen,
freigewerkschaftlichen und sozialdemokratischen
Volksbeglücker das einheitliche Vorgehen
der Arbeiterschaft und den Kampf gegen die den
Lohnabbau machenden Unternehmer, – und buhlen
um die Stimmen der Arbeiter,
aber in der täglichen Praxis zerschlagen sie
überall das einheitliche Vorgehen der verschiedenartig
organisierten Arbeiter und helfen
den Unternehmern, die Kämpfe der hungernden
Arbeiter niederzuschlagen.
Zum Schluß sei noch gesagt, daß wir bereits
am 4. November an die Schriftleitung der SPD-
“Volkszeitung“ und die KPD-“Freiheit“ in Düsseldorf
einen ähnlichen Bericht einsandten. Ich
erklärte mich bereit, für denselben die volle, auch
pressegesetzliche, Verantwortung zu übernehmen.
Die „Freiheit“ sagte die Veröffentlichung sofort zu,
hat den Berict aber noch nicht gebracht Hoffen wir
das Beste. Die SPD-Zeitung rührte sich überhaupt
nicht, das Manuskript bekamen wir erst durch Drohung
mit Zwangsmaßnahmen zurück, natürlich
ohne ein Wort der Entschuldigung. Acht Tage lang
hatten die Volks-Zeitungs-Redakteure über unseren
Streikbericht nachgegrübelt und ihre konservativen
Gehirne angestrengt, wie sie die erhaltene Prügel
wohl am besten parieren könnten.
Schließlich brachte die „Volkszeitung“ am 14.
November einen Bericht mit der Überschrift „Syndikalistische
Lügen über die Lohnbewegung der
Fliesenleger“, der zur Düpierung der Leser berechnet
war. Darin wird wiederum versucht, mit plumpem
Schwindel die Gewerkschaftsbürokratie rein
zu waschen. Wir werden schon dafür sorgen, daß
dies nicht gelingt und die Heldentaten der Gewerkschaftshäuptlinge
und deren untertäniger Diener,
der Volkszeitungsmänner, öffentlich anprangern,
mögen sie noch so sehr geifern und quietschen.
Düsseldorf, den 15. November 1932.
Die gemeinsame Lohnkommission der Fliesenleger
and deren Streikleitung, an der beteiligt sind:
Vereinigung der Fliesenleger (Syndikalisten),
Deutscher Baugewerksbund, Christl. Baugewerkschaft,
I. A.: Carl Windhoff.
• Der Syndikalist, Nr. 47 – 1932 [26. November 1932]


 Rund zwei Monate nach dem Tod eines Jugendlichen in Speyer, der verhungern musste, weil ihm die Behörden durch Sanktionen sämtliche Sozialleistungen versagt hatten (WCN berichtete), hat die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke eingeräumt, die Streichmaßnahmen der örtlichen GfA wären „rechtsfehlerhaft“ gewesen. Konsequenzen, um etwaige zukünftige Todesfälle zu vermeiden, will man aber offenbar nicht daraus ziehen.
Rund zwei Monate nach dem Tod eines Jugendlichen in Speyer, der verhungern musste, weil ihm die Behörden durch Sanktionen sämtliche Sozialleistungen versagt hatten (WCN berichtete), hat die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke eingeräumt, die Streichmaßnahmen der örtlichen GfA wären „rechtsfehlerhaft“ gewesen. Konsequenzen, um etwaige zukünftige Todesfälle zu vermeiden, will man aber offenbar nicht daraus ziehen.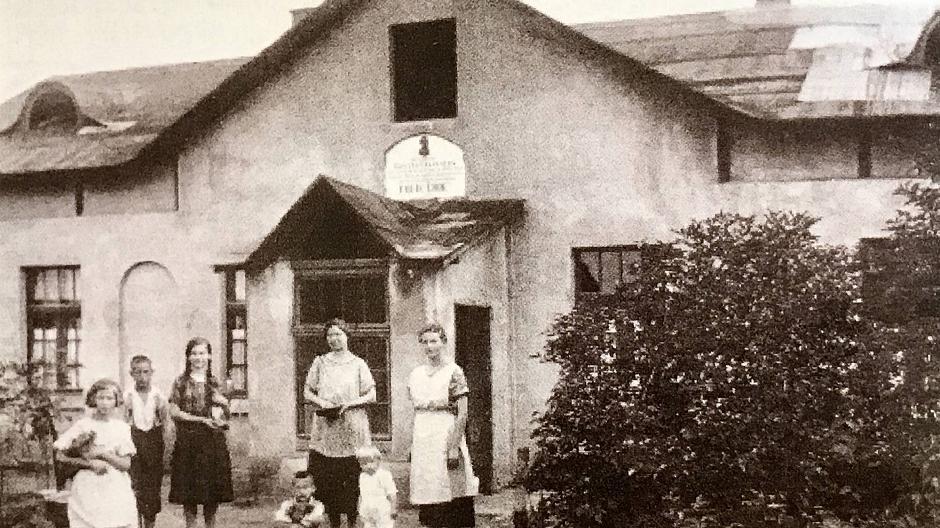



 MARIA UND DAS HOTEL
MARIA UND DAS HOTEL