Diese Woche stimmen die Mitglieder von verdi und GEW darüber ab, ob sie das Einigungspapierzwischen Hochschulleitungen und Tarifkommission (und Senat) akzeptieren und damit den Arbeitskampf beenden. Es ist wichtig, dass darüber abgestimmt wird, aber es ist auch eine Zumutung: Jetzt sollen die studentischen Beschäftigten selber zustimmen, dass es okay ist, dass sie, wenn sie ein Tutorium geben, nur halb so viel dafür verdienen wie ein*e WiMi, die*der ein Tutorium hält. Zugleich ist das Einigungspapier auch ein Erfolg unserer Streiks. Die Gefühle sind gemischt. Entsprechend schwierig fällt es, ein Urteil über die Kampagne und die Abstimmung zu fällen.
Die Zumutung kommt vom Verhandeln
Wenn man als Gewerkschaft Tarifverhandlungen zu einer Einigung führen will, hat man eigentlich nur zwei Optionen: Zugeständnisse in Verhandlungen oder Druck, also tanzen oder boxen. Und leider hatten viele in der Kampagne bis zuletzt nicht daran geglaubt, dass wir genug Druck aufbauen könnten, um mehr als das zu erreichen, worüber wir nun abstimmen sollen.
Der Zweifel an der eigenen Stärke hatte die verdi/GEW-Gremien Ende 2016 dazu bewogen, ohne Kündigung des TV Stud in Tarifverhandlungen zu starten. Wegen der dadurch weiterlaufenden tariflichen „Friedenspflicht“ musste das ganze Jahr 2017 über ohne die Möglichkeit zu Streiks verhandelt werden – der nächste mögliche Kündigungstermin war der 1.1.2018. Obwohl bereits im Frühling 2017 klar wurde, dass die Arbeitgeber*innen niemals kampflos einer Einigung oberhalb von 12 Euro plus Dynamisierung zustimmen würden, hofften die Verhandlungsführer von GEW und verdi, durch weitgehende Zugeständnisse in den Verhandlungen einen Abschluss herbeizuführen. So sprang die Weihnachtsgeld-Wiedereinführung im Sommer 2017 über die Klinge und der Einstieg jenseits der 13 Euro im Herbst. Im Frühling 2018 – noch bevor die Haupt-Streikphase begann – verabschiedeten sich die Verhandler*innen von der Forderung nach einer soliden und zügigen Dynamisierung. In den 2018er Sommersemester-Streiks war also nicht mehr viel von den 2017er Forderungen übrig, um das sich noch kämpfen ließ.
Der Zweifel an der eigenen Stärke und das Setzen auf Verhandlungen durch die Gewerkschaften sind kein historischer Zufall, sondern fest im gesellschaftlichen Gefüge der Bundesrepublik Deutschland verankert. Die sogenannte „Sozialpartnerschaft“ zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeber*innen wurde sowohl nach dem Ersten als auch nach dem Zweiten Weltkrieg von der Politik stark forciert, um den Wiederaufbau nicht durch Arbeitskämpfe in Gefahr zu bringen. Gefördert wurde diese politische Entwicklung vor allem durch die inhaltliche Schnittmenge zwischen sozialdemokratischen Ansätzen und christlicher Soziallehre, wonach die Arbeitgeber*innen in der Pflicht sind, den Forderungen der Arbeitenden entgegen zu kommen und so das Schreckensgespenst des Klassenkampfes zu befrieden.
Über lange Sicht betrachtet befinden wir uns heutzutage in einem Kreislauf, in dem die Gewerkschaften dank der Sozialpartnerschaft immer schwächer werden und sich deshalb immer mehr auf die Sozialpartnerschaft – in Form von Verhandlungen und Interventionen der Politik – verlassen als auf die eigene Kampfkraft. Insbesondere in Zeiten, wo eine allgemeine Spar- und Kürzungspolitik von der Politik mitgetragen wird, lässt sich in Verhandlungen mit Arbeitgeber*innen immer weniger für die Gewerkschaftsmitglieder herausholen.
 Internationaler Frauenstreik?
Internationaler Frauenstreik?

 Mit der Situation von trans[1] Leuten im Allgemeinen haben sich schon viele (trans) Anarchist*innen beschäftigt. Schließlich ist queerer[3] Anarchismus eine anarchistische Strömung. Aus syndikalistischer Perspektive auf die Lohnarbeit hat das Thema bisher nicht viel Aufmerksamkeit erhalten. An Beispielen erklären wir, wie sich die Diskriminierung in der Lohnabhängigkeit äußert, wie sich das mit anderen Diskriminierungsformen überschneidet und überlegen uns, was wir dagegen tun könnten.
Mit der Situation von trans[1] Leuten im Allgemeinen haben sich schon viele (trans) Anarchist*innen beschäftigt. Schließlich ist queerer[3] Anarchismus eine anarchistische Strömung. Aus syndikalistischer Perspektive auf die Lohnarbeit hat das Thema bisher nicht viel Aufmerksamkeit erhalten. An Beispielen erklären wir, wie sich die Diskriminierung in der Lohnabhängigkeit äußert, wie sich das mit anderen Diskriminierungsformen überschneidet und überlegen uns, was wir dagegen tun könnten.



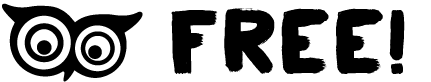 05.07.18 von GeKo Orga
05.07.18 von GeKo Orga Kundgebung der FAU Hannover auf dem Bahnhofsvorplatz am 2.6.2018
Kundgebung der FAU Hannover auf dem Bahnhofsvorplatz am 2.6.2018 „
„